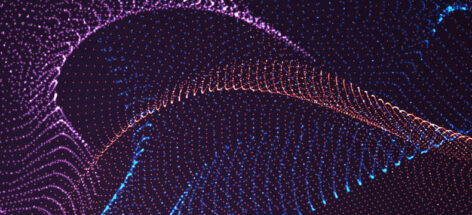News
3. September 2025
Lesezeit: 10
min.
news
Aktuelles zur Forschungsprämie
Das BMF hat einen Entwurf neuer Richtlinien zur Forschungsprämie (FoPR 2025) in Begutachtung geschickt. Bisher fanden sich Auslegungshilfen zur Forschungsprämie in den Einkommensteuerrichtlinien. Die FoPR 2025 umfassen rund 150 Seiten und bringen eine Reihe von Klarstellungen, enthalten aber auch Verschärfungen, die ab dem Kalenderjahr 2026 anwendbar sein sollen.
TPA Newsletter abonnieren
Unsere Expert:innen informieren Sie über alle wichtigen Steuer-Änderungen!
Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung der Inhalte des FoPR 2025 mit Fokus auf die wichtigsten Neuerungen und Änderungen, die die Regelung der Forschungsprämie im Vergleich zu den bisherigen Richtlinien und zur Forschungsprämienverordnung betreffen.
Forschungsprämie
Wesentliche Änderungen durch FoRP 2025 im Kurz-Überblick
Die FoPR 2025 haben – zusammen mit der aktuellen Fassung der FoPV – das System der Forschungsprämie sachlich nicht revolutioniert, aber an vielen Stellen geschärft und erweitert.
- Wesentliche Neuerungen sind die Berücksichtigung des fiktiven Unternehmerlohns (erstmals 2022 eingeführt) und die ausführliche Behandlung von Spezialfällen (Verbundforschung, klinische Studien).
- Inhaltliche Änderungen liegen in detaillierten Handlungsanleitungen (v.a. Personalkosten- und Gemeinkostenberechnung, Dokumentationsanforderungen), die zu denen bisher keine pubilzierte Verwaltungsmeinung vorlag. Diese werden zu einer einheitlicheren Vollziehung und voraussichtlich auch weniger Konflikten bei Betriebsprüfungen führen.
- Inhaltliche Kontinuität besteht hingegen bei den Förderkriterien selbst – was als FuE gilt, welche Kosten grundsätzlich förderbar sind und dass die 14%-Prämie steuerfrei bleibt.
TPA TIPP
Unternehmen sollten vor allem die neu hervorgehobenen Punkte (präzise Zeiterfassung im Bereich der Personalaufwendungen, klare Abgrenzung Auftragsforschung, geänderte Nachweispflichten bei Kooperationen etc.) beachten, um weiterhin in vollem Umfang von der Forschungsprämie profitieren zu können.
Allgemeines (Anspruchsvoraussetzungen und Grundlagen)
Forschungsprämie: Rechtsgrundlage & Geltung
Die nach wie vor in Höhe von 14% vorgesehene Forschungsprämie kann für eigenbetriebliche (selbst durchgeführte) Forschung und Entwicklung (FuE) und für Auftragsforschung beansprucht werden (§ 108c Abs. 2 Z 1 und Z 2 EStG). Die FoPR 2025 betonen – wie bislang schon die EStR – den Charakter der Richtlinien als Auslegungsbehelf: Über gesetzliche Bestimmungen hinausgehende Rechte können daraus nicht abgeleitet werden.
Anspruchsberechtigte Personen
Anspruchsberechtigt für die Forschungsprämie sind – wie bisher – unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, Mitunternehmerschaften sowie Körperschaften (soweit nicht körperschaftsteuerbefreit). Die FoPR 2025 übernehmen im Wesentlichen die bisherigen Kriterien, ergänzen die EStR aber besonders um Beispiele und Hinweise zu folgenden Themen:
Mitunternehmerschaften
Die Forschungsprämie steht der Mitunternehmerschaft selbst zu und ist nur diese antragsberechtigt. Die FoPR 2025 führen nun ausführliche Beispiele an (z.B. Bildung einer GesbR für ein Einzelprojekt unter 700.000 €, die keine einkommensteuerliche Mitunternehmerschaft darstellt: diesfalls steht die Prämie den Gesellschaftern anteilig zu). Diese Klarstellung findet sich in den EStR nicht. Sie entspricht aber der bisherigen Rechtslage (§ 2 Abs. 4 EStG 1988) und Rechtsprechung.
TPA TIPP
Bei atypisch stillen Gesellschaften kommt es oftmals vor, dass das FFG-Gutachten unter der Steuernummer des Inhaber des Unternehmens (IdU) und nicht für atypisch stillen Gesellschaft beantragt wird. Ertragsteuerlich werden die F&E Ausgaben in der Regel der Mitunternehmerschaft zugerechnet. Da die Forschungsprämie an den ertragsteuerlichen Betriebsausgabenbegriff anknüpft, ist in diesen Fällen in der Regel nur die atypisch stille Gesellschaft anspruchsberechtigt.
Körperschaften
Unverändert gilt, dass nur steuerpflichtige Körperschaften die Forschungsprämie erhalten können. Neu ist, dass Körperschaften öffentlichen Rechts grundsätzlich ausgeschlossen sind, außer für deren Betriebe gewerblicher Art, sofern dort FuE betrieben wird. Auch die Behandlung von Unternehmensgruppen (§ 9 KStG) wird klargestellt: Jeder Gruppenträger und jedes Gruppenmitglied beantragt für sein eigenes FuE-Vorhaben die Prämie – eine Konzernzurechnung wie bei der KÖSt-Gruppenbesteuerung findet nicht statt. Diese Präzisierungen entsprechen den früheren Erläuterungen (Rz 8208a EStR) und der Verwaltungspraxis.
Forschung und experimentelle Entwicklung (Begriffsbestimmungen)
Dieses Kapitel definiert, wann eine Tätigkeit als Forschung und experimentelle Entwicklung (FuE) im Sinne der Forschungsprämie gilt. Im Vergleich zu den bisherigen Richtlinien sind die Kerninhalte gleich geblieben, allerdings wurden viele Begriffe präzisiert, mit Beispielen versehen oder an die aktuelle OECD-Terminologie (Frascati-Manual 2015) und Rechtsprechung angepasst.
Definition FuE und Bereiche
Die FoPR 2025 stellen klar, dass Forschung und Entwicklung eine schöpferische, systematische Tätigkeit mit dem Ziel neuer Erkenntnisse oder Anwendungen ist.
5 FuE-Kriterien der Forschungsprämie
Die FoPR 2025 führen – wie die EStR zuvor – die 5 Kriterien an, die ein Projekt erfüllen muss, um als begünstigte FuE zu gelten.
5 FuE Kriterien:
- neuartig
- schöpferisch
- systematisch
- ungewiss
- übertragbar/reproduzierbar
Neu ist, dass die Richtlinien hier stärker auf die Judikatur eingehen: So wird z.B. beim Kriterium Neuartigkeit ausführlich erläutert, dass eine Lösung für den Fachmann nicht offensichtlich sein darf und dass es aber auch keiner „offenkundigen Wissenslücke“ bedarf – entscheidend ist, dass die gefundene Lösung über den bisherigen Stand des Wissens und der Technik hinausgeht. Diese Klarstellung basiert auf VwGH-Entscheidungen aus den Jahren 2015 und 2017. Weiters wird klargestellt, dass Patentierung allein nicht als FuE-Nachweis genügt.
In den FoPR sind auch konkrete Negativabgrenzungen enthalten („keine FuE bei bloßer Kopie, Nachahmung, Reverse Engineering“) – das war implizit bereits bisher der Fall, wird aber jetzt ausdrücklich genannt.
Zusammengefasst weicht die inhaltliche Definition von FuE nicht von den bisherigen Richtlinien und der FoPV ab, die FoPR 2025 enthalten aber begrüßenswerte Ergänzungen:
- mehr Klarheit durch Verweise auf aktuelle Urteile und das aktualisierte Frascati-Manual.
- eine systematische Liste von Abgrenzungsfällen (einschließlich neuerer Begriffe wie „Feedback-FuE“ für Nachentwicklungen nach Markteinführung).
- Beispielsammlung zur Verdeutlichung: Die Beispiele (insbesondere zu Up-Scaling, Pilotanlagen, phasenweiser FuE-Beendigung bei Prototypen etc.) sind ausführlich, was die Anwendung vereinfachen soll. Begriffe derFoPV-werden nunmehr in den FoPR erläutert.
TPA TIPP
In der Praxis kommt oft vor, dass F&E Projekte nicht ausreichend dokumentiert sind. Damit ist das Kriterium der Übertragbarkeit und Reproduzierbarkeit verletzt und die Forschungsprämie kann deswegen nachträglich aberkannt werden. Achten Sie auf eine klare und vollständige Dokumentation des gesamten Projekts vor allem in Bezug auf die 5 Forschungskriterien für die nächste Betriebsprüfung!
Eigenbetriebliche Forschung und Entwicklung (intern durchgeführte FuE)
In Kapitel 3 präzisieren die FoPR 2025 die Voraussetzungen für die eigenbetriebliche Forschung und Entwicklung (FuE).
Eigenbetrieblich vs. Auftragsforschung
Eigenbetriebliche FuE liegt vor, wenn das Unternehmen eigene personelle und sachliche Ressourcen einsetzt und die Projektverantwortung selbst trägt. Externe Zuarbeiten (Zukauf von Leistungen) schließen die Eigenforschung nicht aus, solange sie nicht den Kern des Projekts ausmachen und kein echtes Auftragsforschungsverhältnis begründen.
Inländischer FuE-Ort
FuE muss in einem inländischen Betrieb oder einer inländischen Betriebsstätte erfolgen (§ 108c Abs. 2 Z 1). Die FoPR 2025 erläutern diesen Umstand nunmehr anhand von Beispielen ausführlicher.
Beginn und Ende eines FuE-Projekts
Ein eigener Abschnitt (Rz 115–121 FoPR) befasst sich mit der zeitlichen Abgrenzung, in welchen Phasen ein Projekt prämienbegünstigte FuE darstellt. Es wird zwischen Vorbereitungsphase, Durchführungsphase und nachgelagerten Aktivitäten unterschieden. Die Prämie gibt es nur für die eigentliche FuE-Phase.
Fiktiver Unternehmerlohn
Seit 2022 (durch das AbgÄG 2022) können Einzelunternehmer, Mitunternehmer oder unentgeltlich mitarbeitende Gesellschafter eine fiktive Eigenvergütung als Teil der prämienbegünstigten Kosten ansetzen. Die FoPV wurde dazu geändert, die FoPR 2025 enthält nun erstmalig ausführliche Vorgaben in Rz 346–349:
- Pro Person und Wirtschaftsjahr können bis zu 1.720 FuE-Stunden angesetzt werden. Für 2023 galt ein Stundensatz von EUR 45, ab 2024 beträgt er EUR 50 – somit maximal ERU 86.000 p.a. als Bemessungsgrundlage pro Person.<
- Eine exakte Zeitaufzeichnung mit Tätigkeitsbeschreibung ist erforderlich. Die FoPR betonen, dass eine bloße Glaubhaftmachung nicht genügt – das zeitliche Ausmaß und die Tätigkeit sind detailliert nachzuweisen.
- Neu gegenüber den vorigen Richtlinien ist auch die Regel, dass dieser fiktive Lohn nur insoweit zusteht, als nicht ohnehin ein Gehalt oder Vergütung gezahlt wurde. D.h. Geschäftsführer einer GmbH, die ohnedies entlohnt werden, können nicht für dieselbe Tätigkeit zusätzlich den fiktiven Lohn ansetzen. Die FoPR 2025 enthalten dazu Beispiele (z.B. Gesellschafter-GF verzichtet monatsweise auf Gehalt => für diese Monate kann fiktiver Lohn beansprucht werden).
TPA TIPP
Sofern unentgeltliche Eigenleistungen von Unternehmern für Forschungszwecke erbracht werden, sind darüber detaillierte Aufzeichnungen zu führen, damit der fiktive Unternehmerlohn in die Bemessungsgrundlage einfließen kann.
Auftragsforschung (an Dritte vergebene FuE)
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Auftragsforschung im Zusammenhang mit der Forschungsprämie bleiben unverändert gegenüber früher (Höchstbetrag 1 Mio, Empfängerkreis, Ausschluss Konzern, Mitteilungserfordernis). Aber die FoPR 2025 schaffen größere Klarheit in der Anwendung – hervorzuheben sind die folgenden Themenbereiche:
Abgrenzung zu unterstützenden Zukäufen
Eine der praxisrelevantesten Klarstellungen ist in den Rz 154–155 FoPR enthalten: Hier wird herausgearbeitet, dass nicht jeder extern vergebene Auftrag gleich „Auftragsforschung“ ist. Tätigkeiten, die kein eigenes FuE-Projekt darstellen (z.B. reine Hilfs- oder Testarbeiten), können daher Teil der eigenbetrieblichen FuE bleiben. Die FoPR enthalten eine Liste typischer Hilfs- und Supportleistungen, die nicht als eigenständige FuE-Aufträge anzusehen sind.
Hilfs- und Supportleistungen, die nicht als FuE-Aufträge gelten
- Literatur- und Materialsuchen
- Versuchsdurchführungen nach Anweisung
- Prototypenbau nach Plänen des Auftraggebers
- Gerätwartung
- Datenerhebungen
- Zuarbeit bei Auswertungen
- usw.
In Rz 158 FoPR wird ein Fall missbräuchlicher Gestaltungen iZm der Auftragsforschung im Konzernverbund dargestellt: Eine nicht forschende inländische (Vertriebs-)Gesellschaft vergibt allein wegen der Prämie FuE-Aufträge an Dritte und überlässt die Ergebnisse unmittelbar an eine ausländische Konzerngesellschaft in Form einer Weiterverrechnung ohne Gewinnaufschlag. Sofern kein wirtschaftlicher Konnex zur Geschäftstätigkeit besteht, liegt diesbezüglich ein Missbrauchstatbestand vor.
Forschungskooperationen und Spezialfälle (Kooperationen, COMET, Pharma-Forschung)
Dieses Kapitel in den FoPR 2025 (Rz 200–216) behandelt konzertierte FuE-Vorhaben, die nicht klassische Einzelaufträge sind – also z.B. Joint Ventures, Konsortien (COMET-Zentren) oder Besonderheiten der pharmazeutischen Forschung.
Dieses Kapitel ist in weiten Teilen neu gegenüber den bisherigen Richtlinien. Es greift spezielle Strukturen auf, zu denen bisher nur eine eingeschränkte Verwaltungsmeinung vorlag:
- Kooperative FuE ohne Auftragsverhältnis: Nun eindeutig: jeder Partner nur für eig. FuE-Aufwand, Barleistungen an das COMET Zentrum sind nicht begünstigt.
- Förderprogramme wie COMET: Mit den FoPR 2025 gibt es erstmals klare Spielregeln zur Aufteilung der Prämiennutzung zwischen Zentrum und Partnern – davor fehlte eine offizielle Verwaltungsmeinung.
- Pharma: Erstmals werden klinische Forschungsstadien prämientechnisch eingeordnet und die Rollenklärung (Sponsor vs. Prüfarzt vs. CRO) vorgenommen. Die FoPR schafft hier Rechtssicherheit für eine Branche mit komplexen FuE-Ketten.
FuE-Kooperationen („Joint Ventures“)
Wenn unabhängige Unternehmen gemeinsam forschen, ohne dass ein formeller Forschungsauftrag vorliegt, stellt sich die Frage der Prämienberechtigung. Die FoPR 2025 stellen hier klar:
- Mitunternehmerschaft vs. Kooperation: Findet die Kooperation in Form einer steuerlichen Mitunternehmerschaft statt, beantragt die Mitunternehmerschaft die Prämie selbst. Erfolgt die Zusammenarbeit dagegen ohne Mitunternehmerschaft (z.B. bloßer Kooperationsvertrag), so trägt jeder Partner seinen Aufwand selbst und kann dafür die Forschungsprämie beantragen. Es wird betont, dass jeder Partner nur seine eigene prämienfähige Leistung ansetzen kann und etwaige Kostenumlagen keine zusätzliche Prämienbasis schaffen. Mit anderen Worten: Jeder erhält die Prämie nur für die Tätigkeiten, die er selbst als FuE erfüllt – reines Bezahlen von Geldbeiträgen ohne eigene FuE-Leistung begründet keinen Anspruch.
- Die FoPR 2025 warnen auch hier vor Umgehungsversuchen: Unternehmen, die nur Finanzierungsbeiträge leisten, aber selbst keine FuE durchführen, erhalten keine Prämie. Diese einschränkende Sicht soll verhindern, dass man z.B. über Konstruktionen mit gegenseitigen Kostenverrechnungen versucht, eine Art Auftragsforschung innerhalb eines Konsortiums vorzutäuschen.
COMET-Zentren (Kooperation Wissenschaft – Wirtschaft)
Die FoPR gehen speziell auf das COMET-Programm (Kompetenzzentren) ein, wo Unternehmenspartner Geld- und Sachleistungen einbringen. Hier gab es in der Vergangenheit Unsicherheit, wer die Forschungsprämie für was beanspruchen darf. Rz 204–207 FoPR liefern dazu klare Regeln:
In-kind Leistungen
Erbringt ein Unternehmenspartner Sach- oder Personalleistungen im COMET-Zentrum (angerechnet auf seine Verpflichtungen), so kann – je nach vertraglicher Vereinbarung – entweder das Zentrum oder der Partner diese Aufwendungen für die Prämie ansetzen. Es darf allerdings insgesamt nur einmal gefördert werden. Praktisch ermöglicht dies, dass Partner und Zentrum sich abstimmen, wer welche prämienfähigen Eigenleistungen geltend macht.
Das FoPR bringt ein Beispiel, in dem eine Firma Personal ins Zentrum entsendet; es wird vereinbart, dass die Kosten beim Zentrum berücksichtigt werden – dann beantragt das Zentrum die Prämie, nicht die Firma. Alternativ könnte vereinbart werden, dass der Partner seinen Aufwand selbst ansetzt – dann verzichtet das Zentrum darauf.
Cash-Beiträge
Reine Geldzuschüsse der Unternehmen an das COMET-Zentrum sind nicht prämienbegünstigt für den Partner. Denn hier erbringt der Partner keine eigene FuE-Leistung – er finanziert nur fremde Forschung. (Dieser Fall deckt sich mit der generellen Aussage zu Finanzierungsbeiträgen oben.)
Forschungsprämie Bemessungsgrundlage für eigenbetriebliche FuE (prämienfähige Aufwendungen)
Neu ist in diesem Bereich, dass die FoPR 2025 sehr ausführliche Hinweise zur Ermittlung und Dokumentation dieser Aufwendungen geben. Im Folgenden gehen wir nur auf die Verwaltungsmeinung bei der Ermittlung der förderungsfähigen Personalaufwendungen ein, da hier die wesentlichsten Verschärfungen zu beachten sind:
- Die Personalstundensätze pro Mitarbeiter sind nach folgender Formel zu ermitteln: Für jeden FuE-Mitarbeiter Jahreslohnkosten / tatsächlich geleistete Arbeitsstunden = EUR-Satz.
- Zu rechnen ist immer nur mit geleisteten Arbeitsstunden.
- Falls eine genaue Zeiterfassung fehlt, erlauben die FoPR eine vereinfachte Schätzung der Produktivstunden basierend auf statistischen Erfahrungswerten (z.B. 212 Arbeitstage im Jahr bei 8 Std/Tag ≈ 1.696 Stunden, abzüglich Überstunden oder plus bei Teilzeit entsprechend).
- Warnung vor falschen Methoden: Das FoPR untersagt explizit, statt der Anwesenheitsstunden nur „produktive Stunden“ zu rechnen (was zu überhöhten Stundensätzen führen würde, indem man Auslastungsverluste auf die FuE-Stunden umlegt). Dies soll Missbrauch (Überhöhung der Basis) verhindern, da manche Antragsteller bislang mit Sollstunden oder „Produktivfaktoren“ rechneten. Die Richtlinie sehen vor, den tatsächlichen Ist-Aufwand zugrunde zu legen und ggf. Plankosten auf Istkosten zurückzurechnen.
- Pauschale Stundensätze: Für homogene Gruppen von Mitarbeitern kann ein Durchschnittssatz verwendet werden, wenn eine Einzelberechnung unverhältnismäßig aufwändig wäre – aber nur, wenn die Gehälter in der Gruppe ähnlich sind und das Ergebnis nahezu gleich wie bei Einzelrechnung wäre. Beispiel: In einer Abteilung mit sehr ähnlichem Gehaltsniveau kann ein einheitlicher Stundensatz herangezogen werden, wenn getestet wurde, dass dieser dem individuellen Aufwand nahekommt.
- Zeiterfassungspflicht: Schon bisher galt, dass für prämienrelevante Personalkosten Projektzeiten-Aufzeichnungen nötig sind. Die FoPR 2025 unterstreichen dies erneut: Alle Tätigkeiten müssen in einem Zeiterfassungssystem oder zumindest händisch erfasst und dem FuE-Projekt zugeordnet werden. Es sollen 100% der Arbeitszeit so dokumentiert sein, entweder direkt projektbezogen oder (falls nicht direkt zuordenbar) als „nicht-projektbezogene FuE-Tätigkeit“.